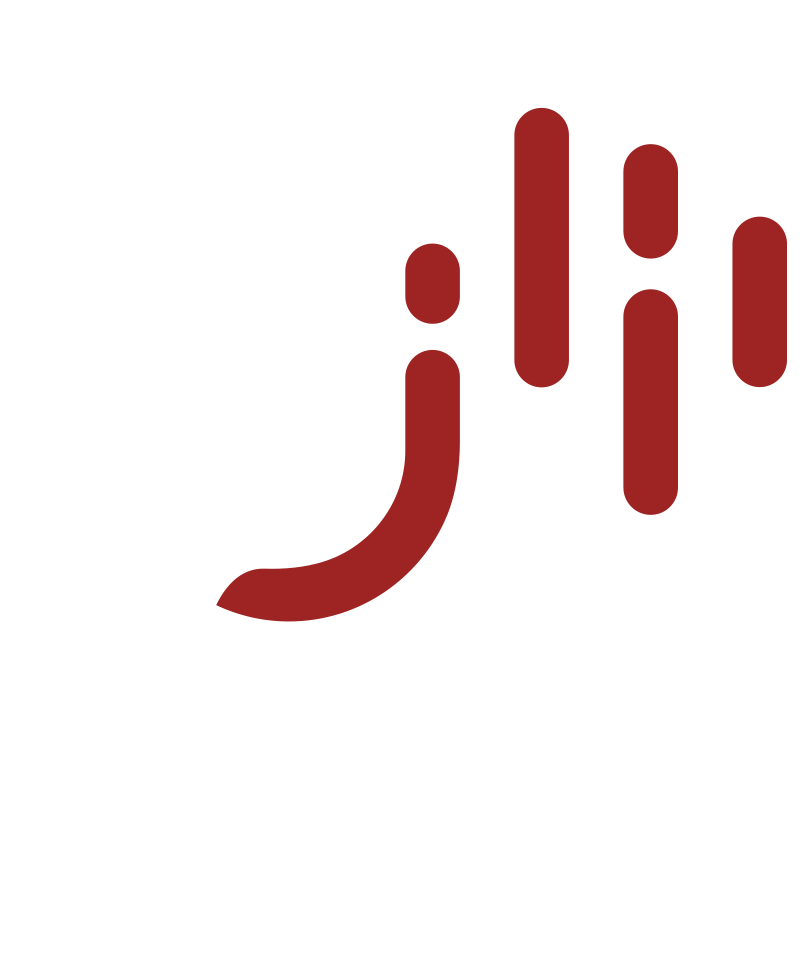00:00:00 DOMINIK BARTELS
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Grenzerzählungen. Heute mit zwei besonderen Gästen, die wir uns eingeladen haben. Sie kommen beide aus Braunschweig und sind beide dort tätig an der TU, an der dortigen, und zwar im Fach "Geschichtsdidaktik". Das heißt, ganz grob übersetzt, die beiden kümmern sich darum, die kommenden zukünftigen Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer auszubilden, ihnen beizubringen, wie man das Fachgeschichte am besten an die Schülerinnen oder den Schüler bringt. Benedikt Einert, geboren 1987 in Hildesheim und seit 2007 jetzt da tätig an der TU in Braunschweig. Und, das kann man vielleicht an dieser Stelle mal sagen, weil es ganz witzig ist, auch Leiter des Eulenspielmuseums in Schattenstedt. Wer da noch nie war, geht da mal hin. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und Herr Doktor Michael Plönus, geboren 1972 in Sondershausen.
----
00:00:53 DOMINIK BARTELS
Das ist in Thüringen, auch unweit der innerdeutschen Grenze gelegen. Und ja. ist dann auch 2007 durch einen guten Kollegen oder Chef nach Braunschweig gekommen an die dortige TU und die beiden sind dort tätig im Fach Geschichtsdidaktik. Herzlich willkommen, euch beiden. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und wir würden gerne mal einsteigen, oder ich würde gerne ganz einsteigen mit einer kurzen, knackigen Frage. Ich habe es eben bei der Vorstellung, nicht umsonst eure Geburtsjahrgänge, unfairerweise, einfach schon mal gesagt. Denn das hat auch noch einen guten Hintergrund, weil wir natürlich bei dieser... bei diesem Podcast uns gedacht haben, wir laden nicht nur Ost und West ein, sondern wollen auch verschiedene Generationen zusammenbringen. Also wir haben einen älteren Wissenschaftler und einen Jüngeren an den Tisch gebracht. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, so aus eurer Sicht, gibt es denn dort Unterschiede, wenn man nicht nur aus Ost oder West kommt, sondern eben auch was die Generation angeht. Und zwar ganz besonders eben, was euer Interesse und den Blick auf die deutsche Teilung und die innerdeutsche Grenze angeht? Benedikt.
----
00:01:59 BENEDIKT EINERT
Das ist eine richtig schwere Frage. Also natürlich gibt es den, der Generationenunterschied liegt schon deshalb auf der Hand, weil ich, ja wie gesagt, Jahrgang 1987 bin. Das heißt, als die innerdeutsche Grenze in sich zusammengefallen ist und die DDR abgewickelt wurde, war ich zwei Jahre alt und Michael in der Pubertät, also fast raus.
----
00:02:21 MICHAEL PLOENUS
Mittendrin.
----
00:02:23 BENEDIKT EINERT
Das prägt natürlich die Perspektive auf diese Ereignisse und unsere Wahrnehmung dieser historischen Zeit, selbstverständlich. Das ist vielleicht der entscheidendste Unterschied, wenn es darum geht, sich damit zu beschäftigen, weil ich nicht Gefahr laufe, würde ich sagen, oder mir nicht die Frage stellen muss, wenn ich mich mit der Geschichte der deutschen Teilung beschäftige: Wo sind meine Prägungen jetzt möglicherweise entscheidend für meine Perspektive? Also weil dieses Thema mich nicht prägen konnte, so wie es ein Zeitzeugen möglicherweise geprägt hat.
----
00:03:02 MICHAEL PLOENUS
Das sind ja zwei Fragen auch gewesen. Erstmal, wie verstehen wir uns über die Generation hinweg? Ich würde sagen, prächtig, was daran liegt, dass Benedikt älter ist, geistig, als er auf dem Papier ist. Und bei mir ist es wahrscheinlich eher umgedreht. als junger Mensch überhaupt nicht so sehr beschäftigt, auch später nicht unbedingt. Das war eher meine Zeit in der DDR. Also mittelbar ist das natürlich dann schon die Teilung. Aber auch heute interessiert mich das Leben in der DDR, mein eigenes, aber auch das meiner Landsleute von einst und heute, mehr als die Teilung als solche. Das kam dann eher durch den Standort Braunschweig, die Lage, am oder im ehemaligen Zonenrand, dass es dadurch dann auch ein professionelles Interesse gab.
----
00:03:58 DOMINIK BARTELS
Das ist eine schöne Überleitung. Michael, ihr habt ja beide auch verschiedene Projekte angestoßen, ins Leben gerufen, weil ihr gesagt habt, okay, die TU Braunschweig mit ihrer geografischen Lage ist ja fast prädestiniert dafür, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, also mit der innerdeutschen Grenze, mit der Teilung, was da so passiert ist, historisch gesehen, geschichtlich gesehen. Mich würde mal interessieren, Geschichte kommt ja auch so, schon rein semantisch gesehen, von Geschichten. Gibt es denn eine Geschichte, die euch besonders berührt oder überrascht hat? Sei es aus Archiven, Zeitzeugenberichten oder vielleicht sogar aus der eigenen Forschung, wo ihr sagt, doch, das war etwas, das ist mir wirklich ganz prägnant in Erinnerung geblieben.
----
00:04:40 BENEDIKT EINERT
Ich habe tatsächlich vor ganz kurzer Zeit von einem Projekt in einer Schule in Heidelberg erfahren. Ich arbeite mit dem Thema gar nicht mehr so tief, weil ich ja wie gesagt beruflich mittlerweile auch auf anderen Baustellen unterwegs bin. Aber es hat sich eine Schülerin aus Heidelberg bei mir gemeldet, aus der Mittelstufe eines Gymnasiums, weil sie einen Aussatz von mir gelesen hat zum Thema innerdeutsche Grenze. Und sie wollte von mir Hilfe dabei, in den Archiven hier vor Ort Quellen zu recherchieren zur Fluchtgeschichte ihrer Großmutter. Die ist als Sechs- oder Siebenjährige mitte der 50er Jahre von Sachsen-Anhalt bei Helmstedt durch den Wald in den Westen geflohen. Ist da von der Mutter quasi in den Wald gebracht worden. Und dann hat sie zu ihr gesagt, du musst einfach an diesem Bus vorbei, da rüber laufen. Und auf der anderen Seite nimmt dich jemand in Empfang. In der Hoffnung, dass da ein westdeutscher Polizist steht. Und das war so. Und dann ist das am Ende, das ist alles gut gegangen. Und die Geschichte bohrt also. Und das finde ich daran so interessant. Das ist ja diese Geschichte, die gibt es ja hunderttausend Mal. Die ist gar nicht besonders. Das musste ich ihr dann leider auch sagen, dass wir wahrscheinlich diesen Fall nicht rekonstruieren können. Eben weil es kein Sonderfall ist, sondern ein Massenphänomen eigentlich. Aber es war für mich total bewegend und auch interessant zu sehen, dass sich das über zwei Generationen hinweg fortsetzt. das Thema seit Jahrzehnten mittlerweile abgewickelt ist, immer noch fortlebt in den Köpfen, selbst der ganz jungen Leute in Deutschland.
----
00:06:22 MICHAEL PLOENUS
Ich musste gerade angestrengt nachdenken. Ich muss fairerweise sagen, das ist fast schon so ein bisschen wie der professionelle Blick des Arztes auf den Patienten, dass einem die Dinge und Geschichte, da geht es ja nun viel um Leid und Tragik, um das Menschsein in all seinen Formen, dass man da schon ziemlich abgebrüht ist, wenn man sich mit dem Ding mischt. Das muss man auch sein. Also ich habe Freunde, die arbeiten viel im Bereich Nationalsozialismus, Euthanasie und das seit Jahren und Jahrzehnten. Also da entwickelt man eine professionelle Distanz. Aber mir ist eingefallen, und ich weiß nicht, Benedikt, ob du dabei warst, wir hatten mal einen Zöllner eingeladen. Also einen, der für den bundesdeutschen Zoll gearbeitet hat. Und er erzählte, Und er redete sich dann regelrecht in einen Tränenfluss von einer Geschichte, dass bei einem versuchten Grenzübertritt eine Mine hochging und der oder demjenigen die Beine weggerissen worden. Und er erzählte das in einer dritten Person. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte ausging, ob derjenige gestorben ist oder nach drüben gezogen wurde, wie auch immer. Man merkte, er versuchte, das Verfremden zu erzählen in der dritten Person. Es kann auch tatsächlich ein Kollege gewesen sein, eben nahestehender Kollege, von dem er erzählt. Aber wir hatten alle, Studierende waren dabei, das Gefühl, er erzählt hier seine Geschichte. Und selbst wenn es nicht seine Geschichte gewesen ist, dann war es die Geschichte deines Kollegen, die einfach nur zeigt, was eben auch diese Grenze für Geschichten hervorgebracht hat, die bis heute, wie du sagst, auch nachwirken. Bei mir persönlich nicht, einfach mangels Erfahrung eines Lebens an der innerdeutschen Grenze. Also wie gesagt, da eher der professionelle Blick.
----
00:08:12 BENEDIKT EINERT
Aber das ist vielleicht auch schon so ein bisschen ein Strukturmerkmal bei dem, was wir da gesehen haben, womit wir uns beschäftigt haben im Rahmen dieses Projekts. Da ging es ja eben ganz explizit um Grenzerfahrungen und das setzt eben den Menschen voraus. Die Geschichten, die sich bei uns eingesenkt haben. die auch dann in der universitären Lehre und auch wenn wir darüber öffentlich gesprochen haben und so immer den größten Nachhall ausgelöst haben, waren eben diejenigen, die wir von Menschen als Zeitzeugen gehört haben. Und insofern fand ich das jetzt einfach interessant, dass beide Geschichten, die wir erzählt haben, auf genau die Art und Weise zu uns gekommen sind. Also da ist jemand, der sich öffnet und das Gespräch sucht mit den Historikern, um einfach seine Geschichte mitzuteilen. Und die wird es hier halt zehntausendfach geben.
----
00:08:58 MICHAEL PLOENUS
Nicht immer funktionieren diese Geschichten in der Vermittlung selbst. Wenn sie vor allen Dingen aus zweiter Hand kommen und nicht von den Zeitzeugen selbst, da hat man immer den nötigen Respekt und hört zu. Aber das geht schon in den Bereich des Anekdotischen und ich weiß nicht, ob wir darauf noch kommen. Also die Geschichten, die wir auch erlebt haben bei unseren Recherchen und bei der Beschäftigung mit dem Thema, die sind ja nochmal zu trennen von den Geschichten, die uns dann selbst auch erzählt wurden.
----
00:09:27 DOMINIK BARTELS
Was würdet ihr beide denn sagen, vor welchen Herausforderungen steht man denn in der Geschichtsdidaktik, wenn die Studierenden, die bei euch ja zu Gast sind in der TU Braunschweig, immer weniger persönlichen Bezug zur deutschen Teilung haben? Also die Leute werden ja immer jünger. Also das Thema geht ja schon rein chronologisch halt immer weiter weg von der Lebenswirklichkeit der Studierenden, die ihr unter eure Fittiche habt. Hat das einen Einfluss? Würdet ihr sagen, dass sich da auch die... die Didaktik einfach verändern muss, sollte oder spielt das gar keine Rolle? Bleibt das im Grunde genommen fast immer so gleich auf wissenschaftlicher Basis?
----
00:10:05 MICHAEL PLOENUS
Ich würde sagen, es darf eigentlich aus professionellen Gründen nicht die Rolle spielen, weil der Historiker, die Historikerin und auch die Lehrerinnen und Lehrer beschäftigen sich ja mit Dingen, die sie nicht erlebt haben. Mit Antike, mit Mittelalter, mit Kriegen, in denen sie nicht selber waren. Also die persönliche Erfahrung kann nicht das Argument für die historische Arbeit sein. Sie steht manchmal auch eher der zeithistorischen Arbeit im Weg. Wir erleben das auch bei unseren Studierenden, die die Geschichten ihrer Großeltern erzählen. Über das Leben in der DDR, was sie selbst nicht kennen. Und sich dann auch batteln untereinander sozusagen. Ich habe gehört, so war es. Nein, so war es nicht. Als ob sie von ihren eigenen Erlebnissen sprechen. Aber es sind die Erlebnisse aus zweiter oder aus dritter Hand. Das ist sogar eher hinderlich dann, um zu einem möglichst, ich will das jetzt nicht zu nüchtern darstellen, aber zu einem möglichst nüchternen und sachlichen Urteil zu kommen. Weil es gibt ja auch den Spruch, der Zeitzeuge ist der schlimmste Feind des Historikers. Gerade wenn man sich mit Zeitgeschichte beschäftigt. Benedikt hat das erlebt. Ich erzähle mal die Geschichte gern. Benedikt hat eine schöne Masterarbeit geschrieben über die Grenzübergangsstelle Helmstedt. Also nicht Marienborn, sondern die westdeutsche Seite. Und hat einen Vortrag dazu gehalten. Eigentlich müsstest du es dir selbst erzählen. Nein, mach mal. Und ich ahnte schon, was passierte. Denn es waren viele grauhaarige ältere Herren im Publikum. Und er war kaum fertig. Da meldet... ein guter Vortrag... dann meldete sich der Erste und stand auf und sagte: "Junger Mann", und da wissen Sie schon, was losgeht, "Junger Mann, ich muss Ihnen sagen, Sie haben vom Thema überhaupt keine Ahnung. Ich habe das alles miterlebt. "Da ist sozusagen die persönliche Betroffenheit oder die vermeintliche Expertise, die man hat, für das historische Urteil eher hinderlich. Aber du kannst ja gerne noch ergänzen.
----
00:11:52 BENEDIKT EINERT
Es gibt vielleicht noch einen zweiten Punkt, was ganz spezifisch mit Braunschweig und der Region hier zu tun hat, würde ich sagen. Also es ist, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so präsent, dass diese Region hier, also von Braunschweig sozusagen in Richtung Osten gedacht, bis zur ehemaligen innerdeutschen Grenze, dass das eine Grenzregion ist. Also das würde man sagen über das ehemalige DDR-Sperrgebiet, aber würde man das sagen über die Region zwischen Braunschweig und Helmstedt. Und da würde ich sagen, sehen wir tatsächlich einen Unterschied über die letzten 10, 15 Jahre bei unseren Studentinnen und Studenten, weil wir doch schon dann immer noch Personen, also Studenten hatten, die so ein bisschen über ihre eigene Regionalgeschichte, über ihre eigene Herkunft aus dem ehemaligen Zonenrandgebiet doch die ein oder andere Geschichte beizutragen hatten. Und mittlerweile ist das Thema, selbst bei denjenigen, die hier aus der Region kommen, so weit weg. dass wir diese Brücke in der Regel im Gespräch in der Lehre auch nicht mehr ohne weiteres geschlagen kriegen. Also das ist mittlerweile meine Wahrnehmung so, dass wenn wir davon erzählen, dass man diesen westdeutschen Grenzraum auch erforschen und auch erzählen kann, selbst bei denjenigen auf Unverständnis oder jedenfalls Überraschungen stoßen, die selber aus der Region kommen. Und das war möglicherweise vor 10, 15 Jahren noch nicht so.
----
00:13:12 MICHAEL PLOENUS
Wobei man auch sagen muss, es gibt Konjunkturen auch innerhalb der Geschichtsvermittlung und Geschichtswissenschaft. Und das Thema Grenze war, als wir uns auch damit beschäftigt haben, intensiver, so um das Jahr 2009, 10, fortfolgende Jahre, war das sehr en vogue. Und es gab eine ganze Reihe von Projekten. Jetzt nicht nur unseres, das war sogar eher ein kleineres, sondern in Hannover gab es etwas, in Helmstedt. Also überall war das Thema da, wurde auch Geld reingepumpt, wurden auch Veranstaltungen öffentlichkeitswirksam durchgeführt. Ich kann mich täuschen, Benedikt, aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen abgeflaut in den letzten Jahren, auch das Interesse für diese Themen in der Breite.
----
00:13:49 BENEDIKT EINERT
Ich würde vielleicht sagen, dass das etwas mit der gesamtgesellschaftlichen Großwetterlage zu tun hat. Also ich hatte dieses Projekt, das wir hatten, wenn wir mit Menschen gesprochen haben, Geschichten eingesammelt haben und auch das vorgestellt haben, den Eindruck, das war, ich will es jetzt nicht zu pauschal sagen, aber... Im Vergleich vielleicht eine harmlosere Form von Politisierung der Menschen, wenn es um dieses Thema geht. Und mittlerweile wird ja irgendwie so dieser Raum, die geteilten Erinnerungen, so hieß das Projekt ja, das wir gemacht haben, das würde man wahrscheinlich vor dem Hintergrund der Diskussion der letzten paar Jahre, ist Ostdeutschland angekommen in der Bundesrepublik, was ist mit der AfD, also so wie das eben gegenwärtig diskutiert wird. Da hatten wir, glaube ich, bei diesem Projekt 2009, 10, 11 den Vorteil, dass wir diese Debatte noch nicht in dieser Größenordnung führen mussten, dass die vielleicht auch gesamtgesellschaftlich so noch nicht da war oder jedenfalls, sagen wir, wenigstens anders geführt wurde. Und mittlerweile ist das einfach anders. Also es ist einfach ein anderer Zugang zum Thema und es ist auf eine andere Art und Weise politisch, als das vorher der Fall war.
----
00:14:57 MICHAEL PLOENUS
Wobei wir auch einen anderen Fokus hatten. Wir haben eben, das muss man vielleicht auch noch zu unserem Projekt sagen, wir kommen vielleicht noch dazu. Es ging uns um eine ganz bestimmte Seite der Grenze. Wenn man über die Grenze, die innerdeutsche Grenze spricht, denken die meisten an DDR und Grenzregime. Und das ist eben nur die eine Seite, die sicherlich populärere und bekanntere. Was ist denn mit der anderen Seite? Und wir haben die Erfahrung gemacht, nicht nur wir, andere auch. Wenn man hier über Grenzen spricht, spricht man auch über die DDR. Hans Beschinski, ein Dichter, hat das mal Ostsucht genannt. Seine eigene Erfahrung aus dem Aufwachsen in diesem innerdeutschen Grenzraum. Es war immer die Sucht, nach drüben zu gucken, nach drüben zu wollen. Uns hat aber interessiert, was ist denn mit den Menschen hier und ihrer Grenzerfahrung? Und bezieht sich die auch immer nur auf die Grenze und auf die DDR? Oder gibt es nicht noch viel mehr zu erzählen? Also was ist mit diesem berühmten Zonenrand? Was gibt es aus dem Zonenrand zu berichten? Und man muss vielleicht dazu sagen, das ist ein sehr unpräziser Begriff, beziehungsweise er ist präzise, wenn man ihn verwaltungsrechtlich nimmt, denn so ist er gemeint. Und er meint mit der Zonenrandförderung ein Gebiet, wenn man es mal wirklich so nimmt, das ein Fünftel der ganzen Bundesrepublik ausmacht. 1400 Kilometer innerdeutsche Grenze haben wir. 40 Kilometer tief in den Raum rein ist der Zonenrand definiert, macht in Summe ein Fünftel der Fläche der Bundesrepublik. Das ist ja schon etwas mehr als nur Rand. Und ja, wie erzählt man eigentlich diese Geschichte? Und gibt es das überhaupt, den typischen Zonenrand? Auf Ostseite haben wir das Sperrgebiet. Und ich behaupte mal, es ist vollkommen egal, ob Sie in Thüringen in irgendein Dorf reingehen oder in Mecklenburg -Vorpommern, überall erzählen sie die gleiche Geschichte des Sperrgebiets. Es gibt sicherlich regionale Unterschiede, aber es ist von oben festgesetzt, was das Sperrgebiet ist und wie das Leben in dem Sperrgebiet zu funktionieren hat. Aber was bitteschön ist auf andere Seite der Zonenrand. Dann sagen viele, naja, es ist so eine abgehängte Region, das Sibirien der Bundesrepublik. Ja, wir haben aber Wolfsburg hier als einen Motor der Wirtschaft der Bundesrepublik. Also Sie merken schon, dass wir die Schwierigkeiten schon hatten. Wenn wir über den Zonenrand reden oder über die Grenzregion, worüber reden wir hier eigentlich? Reden wir über Braunschweig? Reden wir über Schöningen? Und wir waren, glaube ich, am Ende dann bei der Überlegung, wenn man das erzählt, dann erzählt man es als eine Geschichte der Zuschreibung. Das, was Leute als Zonenrand sehen, was vom Osten, zum Beispiel die Stasi, als Zonenrand wahrnimmt, was hier als Zonenrand wahrgenommen wird. Wir haben ja festgestellt, dass die Braunschweiger sich nicht dazu rechnen. Die Schöninger dann schon, also Zonenrand sind immer die anderen. Wie nimmt das jemand aus dem Ruhrgebiet wahr, der als Grenztourist hierher kommt? Wie wird das aus wirtschaftspolitischer Sicht wahrgenommen und so weiter? Das war so der Stand und wenn das Projekt noch laufen würde, wären wir genau dabei, eine Geschichte der Zuschreibungen zu erzählen, aber nicht die Geschichte des Zonenrandes an sich, weil das ist zumindest meine These, geht nicht.
----
00:18:10 DOMINIK BARTELS
Ja, vielen Dank Michael. Das bringt mich auch sehr schön zu meiner nächsten Frage, die auch wirklich sehr gut dazu passt. Ihr habt euch ja beide das ein bisschen ausführlich erklärt, sehr intensiv mit den Geschichten eben auseinandergesetzt, aber eben den Fokus gelegt eben auf dieses Zonenrandgebiet auf der westdeutschen Seite und das ist ja wirklich mal interessant. Und da wäre meine Frage eigentlich so, die innerdeutsche Grenze, das war ja nicht nur so eine politische Trennlinie, sondern ihr hattet ja auch soziale, kulturelle, wirtschaftliche Auswirkungen. Nachdem ihr euch da so sehr intensiv beschäftigt habt, was würdet ihr denn sagen, Welche wenig beachteten Aspekte der Teilung haltet ihr denn für besonders wichtig? Was ist denn bei euch hängen geblieben, wo ihr sagt, so, ja okay, da hat man jetzt nicht so einen wahnsinnig großen Fokus drauf gelegt, das ist aber trotzdem für die Geschichtswissenschaft, für die Geschichtsdidaktik ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr spannender Aspekt, aber der fällt so ein bisschen runter in der Betrachtung. Du hast eben schon gesagt, so ein bisschen eben so, gerade eben auch die Betrachtungsweise der westlichen Seite wird wenig, ja, Wenig beachtet, kommt wenig vor. Gibt es da noch andere Aspekte, wo du sagst: "Das habe ich in der Beschäftigung festgestellt. Da könnte man eigentlich noch ein bisschen mehr drüber reden, mehr drüber publizieren."
----
00:19:21 MICHAEL PLOENUS
Vielleicht noch ein Schritt davor. Also es wäre schon schön, wenn die Menschen hier etwas sensibilisierter für ihre eigene Geschichte wären. Denn das ist vielleicht jetzt der Platz, die Anekdote mal zu erzählen, die dir passiert ist und die eigentlich typisch ist.
----
00:19:33 BENEDIKT EINERT
Ja, ich habe einen Vortrag in meinem Heimatdorf gehalten. Das ist im Landkreis Hildesheim. Ich glaube tatsächlich, da sind auch noch Zornrandmittel geflossen. Obwohl es eigentlich nicht so richtig passt. Also es ist schon relativ weit weg. Und ich habe einen Vortrag gehalten eben über dieses Forschungsprojekt. Zornrandgebiet. Und ja, so 30 ältere Dorfbewohner und ein Landwirt. Ich habe das alles erzählt und der Vortrag war vorbei. Und der stand auf und sagte, das ist ja schön, was sie hier alles erzählen, aber sie sollten doch eigentlich besser über die DDR sprechen, weil das ist doch hier Demokratie gewesen und Ende der Geschichte. Und das fand ich so schön, borniert kann man fast sagen. Die Geschichte ist da, wo Diktatur ist, wo man passiert und nicht wo der Wohlstand herrscht. Genau, das steckt da eigentlich drin. Und der Mann wird, ich meine das nicht böse, aber der wird bestimmt nicht Fukuyama gelesen haben, aber er hat vielleicht das ein bisschen getroffen, so den Gedanken, dass wenn die Demokratie sich durchgesetzt hat gegen diesen, irgendeinen Block, dass dann Geschichte eigentlich aufhört und dass man dann eigentlich nichts mehr erzählen kann. Das war ja so ein bisschen das Gefühl möglicherweise auch in den 1990er Jahren, zumindest am Anfang. Und das hat uns ja auch kräftig wieder eingeholt, muss man sagen. Davon ist ja nicht mehr so viel übrig. Das, glaube ich, beschreibt ein bisschen das Gefühl, das auch vor 1989 schon in diesem Zonenrandgebiet geherrscht hat. Dass auf der anderen Seite die Wachtürme stehen und auf der anderen Seite die Grenzer da oben sind und mit Gewehren. Das eigentlich Spannende passiert aber hier nicht. Stattdessen sind wir maximal, das trifft vielleicht ein bisschen die Empfindung der Zeit. Es gab sicherlich Menschen im Zonenrandgebiet, die sich empfunden haben als im Schatten der Grenze, also auf der Rückseite, auf der abgewandten Seite der Grenze und davon irgendwie betroffen. Weil es auch für mich als Nachgeborenen, also meine Perspektive ist ja eine Perspektive eines Nachgeborenen, nicht plausibel ist anzunehmen, dass Menschen da unmittelbar an dieser ehemaligen Grenzlinie leben, die ja auch nicht nur eine Linie ist, sondern eine harte Grenze und wissen, dass ihr Himmel nur drei Himmelsrichtungen hat und das nicht als Problem empfinden. Ich würde sagen, dass das in der späten Bundesrepublik irgendwie sich ausgewachsen hat, also dass der Trennungsschmerz dann möglicherweise weg war, als die Verbindungen, die es früher zwischen Dörfern gab, die dann abgeschnitten wurden voneinander, sich verwachsen hat. Also die Verbindungen waren dann eben weg und man hat das irgendwann gelernt, damit zu leben auf beiden Seiten. Und vielleicht ging das einfacher im Westen, wenn man die Möglichkeit hatte, sich ansonsten nach Westen frei zu bewegen, als das in der DDR war, wo man eben in diesem Land war. Aber das heißt ja nicht, dass man diese Aspekte der Geschichte heute nicht erzählen müsste und dass es diese Geschichten nicht wert wären. erzählt zu werden. Aber unsere Erfahrung ist auch, dass wenn wir mit Zeitzeugen hier im ehemaligen Zonenlandgebiet gesprochen haben, in der Regel erstmal Abwehr war. Also die haben erstmal uns versucht zu überzeugen, vielleicht auch sich selber, dass es hier eigentlich keine Geschichten zu erzählen gibt. Das war hier in Bundesrepublik und es war ganz normal. Also genau wie im Ruhrgebiet oder in Bonn. Und dann haben sie aber doch relativ viel erzählt. Also von dem Landwirt, der dann, als die grüne Ganze zugemacht wurde, plötzlich nicht mehr zu seinen Feldern konnte. Oder das, sowas haben wir in Offleben zum Beispiel, da ist der ehemalige Friedhof, der Dorffriedhof abgetrennt worden. Und da konnte man die Gräber seiner Eltern nicht mehr besuchen. Das sind doch Geschichten, das sind wahrscheinlich auch traumatisierende Erfahrungen, historische, von denen wir, glaube ich, einfach natürlicherweise angenommen haben, dass es die gibt. Und dass, wenn es sie gibt, wir die auch erzählen müssten oder Menschen, die erzählen wollen, Aber es war, ich würde sagen, auf westdeutscher Seite immer schwieriger als auf ostdeutscher Seite. Und das meint Michael wahrscheinlich, wenn er sagt, man müsste die Leute, das könnte von ihnen erwarten.
----
00:23:37 MICHAEL PLOENUS
Auch ihr Leben hatte narratives Potenzial und war nicht nur vom Gleichklang geprägt, sondern eben auch von der Existenz dieser Grenze. Weil du fragtest, was kann man noch so alles erzählt werden? Das sind manchmal auch ganz kleine Geschichten, irgendwelche Dorfkneipen, die... sich eine goldene Nase, ich übertreibe etwas, durch den Grenztourismus verdient haben, der dann auf einmal wegbrach. Williges Lust war immer so ein Haus irgendwie. Das ist in der Region, glaube ich, bekannt und ist auch wieder eröffnet, glaube ich. Ich glaube, die enkelte Generation führt es fort. Davon gab es halt Weihnachtsfeiern, Betriebsfeiern. Da fielen die Busse am Wochenende aus dem Ruhrgebiet ein. Dieser Gruseltourismus, man guckt mal ein bisschen Grenze, vielleicht sieht man irgendwo einen Grenzer und so. Aber du fragst, was kann außerdem noch erzählt werden? Ja, vor allem auch die Geschichte des schwierigen oder gar nicht gelungenen Zusammenwachsens nach 1989, 1990. Ich kann mich erinnern, wir haben eine sehr schöne Masterarbeit mal betreut, eines Studenten, der hat sich mit den Erinnerungen und Erfahrungen in diesem geteilten Dorf Böckwitz -Zicheri beschäftigt. Also so das kleine Berlin. Also wirklich ein Dorf, zwei Dörfer, die seit... Ewigkeiten, ja, also eigentlich eine Einheit bildeten und wo dann auf einmal wie in Berlin die Mauer durchlief. Und nun ist die Mauer nicht mehr da und nach wie vor hat dieser Ort zwei Infrastrukturen. Ich glaube, zwei Feuerwehren, zwei Blasmusikvereine oder sowas, wenn ich mich recht entsinne. Und man heiratet auch nicht über den ehemaligen Zaun hinweg, sondern bleibt unter sich. Und das ist ganz merkwürdig, wenn man als Außenstehender da reinfährt. Das ist ein Dorf. Da geht es eine Dorfstraße durch und ein Anger. Nichts Besonderes. Aber das Dorf ist geteilt und es ist nach wie vor geteilt. Und allein das hat auch schon Potenzial erzählt zu werden an vielen anderen Orten. Weil man eben doch nicht ohne weiteres anknüpfen konnte an das, was diese Grenze zerschnitten und zerstört hat.
----
00:25:45 BENEDIKT EINERT
Ich hätte vielleicht auch noch was aus meiner eigenen... Aus meiner eigenen Forschung, Michel hat es ja gesagt, als ich gearbeitet habe zur Geschichte des Grenzkontrollpunkts, zur Grenzkontrollstelle Helmstedt, also quasi das Pendant, das kleinere Pendant zur Grenzübergangsstelle Marienborn auf westdeutscher Seite. Und das war für mich per se erstmal, also einfach die Tatsache, dass es das gab, war für mich erstmal ein Aha-Effekt. Ich glaube, das ist eine Perspektive auf die innerdeutsche Grenze, die wenige... kennen, wahrnehmen, also natürlich die Zeitzeugen, die da rübergefahren sind, die wussten natürlich, es gibt Helmstedt und es gibt Marienborn, aber die sind, obwohl sie auch in der architektonischen Anlage und der Funktionsweise relativ ähnlich waren, natürlich mit dem Unterschied, dass in Marienborn eben das Ministerium für Staatssicherheit stand und im Westen Polizisten auf dem Boden des Grundgesetzes, aber dass es zumindest auch in den Kontrollmechanismen, auch in den Empfindungen der Zeitzeugen durchaus Parallelen gab.
----
00:26:46 BENEDIKT EINERT
Und dass man deshalb diesen Raum auch als einen Raum der Mobilität erzählen kann oder des Transits. Das ist etwas, was, glaube ich, in den Erzählungen von der innerdeutschen Grenze, die man ja als sehr statisch erzählt, als ein Bauwerk, das nur dem Zweck dient, Mobilität zu verhindern. Und dann war es für mich also eine überraschende Erkenntnis, obwohl das in der Forschung bekannt ist, dass da durch Marienborn oder überhaupt durch die Grenzübergänge zur DDR, in den mittleren 80er Jahren zum Teil 20 Millionen Reisebewegungen gab.
----
00:27:22 MICHAEL PLOENUS
Das ist auch die Schwierigkeit, vor der die Gedenkstätte Marienbon steht. Was erzählt man dort eigentlich? Man möchte Grenzgeschichte erzählen. Es ist ja eine Gedenkstätte. Man möchte vielleicht auch Tote an der innerdeutschen Grenze erzählen. Aber man muss eigentlich eine Geschichte auch des Transits und der Eröffnung erzählen. Das war ja ein Loch in der Mauer. Und eigentlich, jetzt wo ich dich reden höre, ist es fast bedauerlich, dass auch bei dieser Gedenkstättengründung Marienborn, dass man Helmstedt nicht dazugenommen hat. Dass man diese Seite der Geschichte im Zuge der Aufarbeitung auch nicht auf dem Schirm hatte. Dass man sagt, wir erzählen die Geschichte des Grenzübergangs sicherlich mehr über Marienborn, aber doch bitteschön auch über Helmstedt. Zumal, und das hat ja deine Arbeit gezeigt, das auch ganz interessant ist, auch für mich ganz interessant war, weil ich diese Perspektive nicht hatte, weil sie leider Gottes nur sehr, sehr wenige haben.
----
00:28:20 BENEDIKT EINERT
Und aus heutiger Perspektive müsste man sagen, erzählt diese Geschichte Helmstedts anders als die Marienborns, weil Marienborn steht selbstverständlich für Diktatur und eben Staatssicherheit und Abriegelung und Drangsalierung der eigenen Bürger. (Die dort gar nicht hinkamen.) Genau, die dann nicht hinkamen, aber vielleicht gerne durchgefahren wären. Erzählt Helmstedt eben Bundesrepublikgeschichte. Und zwar eine, die Kontinuitäten bis heute hat. Und wenn wir Geschichte auch als einen Stoff begreifen, der irgendwie an unsere Gegenwart anknüpft oder umgekehrt, dann erzählt eigentlich Helmstedt Geschichten, mit denen wir heute was machen könnten. Also Helmstedt ist ein Ort der Migration beispielsweise. Es ist ja gerade ein Riesenthema. Es ist ein Grenzübergang, an dem Konflikte, die es auch heute zum Thema Migration gibt, auch damals schon stattgefunden haben. Auch damals ist diskutiert worden darum, was macht man in Helmstedt im Bahnhof beispielsweise in dem Moment, wo da tausende Leute ankommen. Ist man da überfordert? Wie geht man damit um? Welche Behörden greifen da ein? Das sind alles Phänomene, die zur Geschichte der Bundesrepublik schon gehören und auch schon gehörten, als es noch eine deutsche Teilung gab.
----
00:29:41 DOMINIK BARTELS
Und habt ihr beide ja bei eurem Projekt mit unglaublich vielen Menschen gesprochen, also euch viele Geschichten gehört, viele Interviews geführt, euch viele Anekdoten draufgeschaufelt. Ich würde jetzt gerne mal so einfach mal so eine Behauptung hier einfach mal in den Raum werfen und euch mal bitten, dass ihr mal überlegt, inwieweit würdet ihr dazu stimmen? Diese innerdeutsche Grenze war ja, wenn man sich jetzt diese Grenzübergänge zum Beispiel anguckt, also Marienborn oder so, dann war das ja nicht nur eine massive physische Barriere gewesen, sondern viele argumentieren ja auch heute noch, dass es eben immer noch, auch jetzt 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, sowas wie eine mentale Mauer gibt. Würdet ihr sagen, dass das zutrifft, diese Behauptung?
----
00:30:22 MICHAEL PLOENUS
Da kommen wir wieder mal zu dem Anfang des Gesprächs, als du gefragt hast, wie wir uns hier vertragen haben, über die Generationen, aber auch über die unterschiedlichen Hintergründe hinweg. Als ich noch im Osten lebte, war ich ein leidenschaftlicher Ossi. Ich meine das jetzt nicht politisch, sondern so, das war halt so mein Erfahrungsraum und das waren die Leute. Und ich habe auch dort in einer DDR -Aufarbeitungsinitiative gearbeitet, also wo man auch rund um die Uhr dann mit Stasi und diesem ganzen Kram beschäftigt ist und wo man auch so seine Vorurteile pflegte gegenüber den Wessis. Und dann war ich hier in Braunschweig und das war wie weggeblasen. Ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie ich da was gedacht habe. Ich habe in Benedikt zum Beispiel, auch wenn er jung ist, nie den Wessi gesehen oder sowas. Oder ich habe auch meine Kolleginnen und Kollegen hier nicht wahrgenommen. Übrigens, dazu und daran ist auch so ein Schmelztiegel. Also es sind auch viele Ossis an der TU gelandet, auch als Professoren. Also es ist nicht nur so, es ist die Ausnahme. Also dass es hier im Westen keine Ossis in führenden Positionen gibt. Also ich will das jetzt nicht übertreiben, um Gottes Willen, aber auch das habe ich hier gelernt. Ich habe mir dann oft verwundert die Augen gerieben, wie ich mal gedacht habe, als ich noch tief in Thüringen lebte und wie unreflektiert das oft war. Also da bin ich auch schon durch eine Schule gegangen, sodass das für mich persönlich jetzt, also nicht mehr so, das Thema ist, obwohl ich die Unterschiede natürlich auch wahrnehme. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die teilweise dann eben von der Enkelgeneration fortgetragen werden und neu erzählt werden. Wie siehst du das, Benedikt?
----
00:31:59 BENEDIKT EINERT
Es gibt die Prägungen. Und die lassen sich ja, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Das würde nicht sagen, die Mauer in den Köpfen. Aber wenn wir zwei miteinander politisch diskutieren, du als im Osten sozialierter Mensch, so?
----
00:32:19 BENEDIKT EINERT
Und ich als einer, der im Westen sozialisiert ist, geboren ist und dann im Gesamtdeutschland sozialisiert ist, dann haben wir schon unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte Dinge. Und da kann man sehr kontrovers darüber diskutieren.
----
00:32:33 DOMINIK BARTELS
Ist das unser Hintergrund oder unser Alter?
----
00:32:35 BENEDIKT EINERT
Beides bestimmt. Und ich würde auch sagen, wir merken das auch beide in dem Moment, wo wir, und das geht bestimmt ganz vielen anderen auch so, wir merken das in dem Moment, dass das, was wir gerade diskutieren, aus unseren Prägungen resultiert und nicht aus unserer Lektüre beispielsweise. Und das ist aber völlig, das ist ja auch völlig in Ordnung, weil das ist ja auch das Geschäft von Wissenschaft und zumal von Geschichtsvermittlung. Diese Debatten nicht nur zu reflektieren, sondern auch selber daran teilzuhaben. Aber die Mauer in den Köpfen ist was anderes. Und das haben wir aber gesehen, wenn wir Leute interviewt haben. Deshalb mag ich das gar nicht so sehr in der Jetztzeit diskutieren, weil das möglicherweise irgendwie in eine zu politische Richtung führt, sondern wir können das, glaube ich, beobachten da, wo wir mit Zeitzeugen sprechen. Und da können wir zurückgehen zu dem Beispiel, das du gerade genannt hast, Böckwitz -Sicheri. Da werden eben Zeitzeugen interviewt aus dem einen Dorf und aus dem anderen Dorf und die beschreiben ja nicht nur die Tatsache, dass da Rituale oder persönliche Beziehungen nicht mehr zusammengewachsen sind, sondern die zeigen in ihren Zeitzeugenaussagen auch, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise übereinander denken. Die machen sich gegenseitig Vorhaltungen, die geben sich zum Teil gegenseitig die Verantwortung dafür, dass es nicht wieder zusammengewachsen ist. Die unterstellen sich gegenseitig aus einer bestimmten Perspektive, möglicherweise nicht zu Unrecht, auf die Dinge zu gucken, auf die gegenwärtige Politik zu gucken, auf das Zusammenleben zu gucken. Und da würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das die Mauer in den Köpfen ist, aber jedenfalls kann man sagen, Da sind sie noch nicht wieder zusammengewachsen. Vielleicht reicht das ja schon, das als eine Mauer in den Köpfen zu begreifen. Das ist aber möglicherweise auch nicht verwunderlich, weil das wohl eine Generationenaufgabe ist. Also eine, die über die Generationen hinweg erfolgen muss. Und ich bin mir sicher, dass mein Sohn beispielsweise, wenn er irgendwann mit Michaels Enkel spielt und über Politik diskutiert, dass die möglicherweise, also höchstwahrscheinlich, eine ganz andere Perspektive auf die Dinge. haben und das erscheint mir sehr natürlich zu sein.
----
00:34:45 DOMINIK BARTELS
Es gibt ja nicht nur in der aktuellen Zeit, sondern eigentlich schon immer so ein oft diskutiertes Thema, wie objektiv kann und sollte Geschichtswissenschaft sein. Gerade bei so einem politisch aufgeladenen Thema wie die deutsche Teilung, also zumindest habe ich das Gefühl, dass es auch immer noch ein politisch aufgeladenes Thema ist. Habt ihr den Eindruck, dass es so etwas wie eine neutrale Geschichtsschreibung oder sowas überhaupt gibt oder ist das eine Illusion, ist das so ein Wunschdenken, wo man sagt so, ja, wir können uns zwar diesem Ideal annähern, sicherlich, das ist auch unser aller Ziel, aber das ist eigentlich also zu 100 Prozent nicht zu erreichen.
----
00:35:24 MICHAEL PLOENUS
Also vielleicht fangen wir mal mit dem Streitfall Geschichte an. Wir diskutieren ja hier über etwas, was wir in der Wissenschaft die Zeitgeschichte nennen. Das ist also die Zeit, in der wir eben leben, die Zeit der Mitlebenden. Und die haben ja alle was zu sagen. Du sagtest ja auch, du hast eine Ostbiografie und wir könnten uns wahrscheinlich jetzt über den Osten unterhalten, über gemeinsame Erfahrungen. Und jeder hat hier mitzureden und jeder glaubt auch mitreden zu können und darf ja auch mitreden. Und Zeitgeschichte ist aber auch immer Streitgeschichte aus genau diesem Grund. Allzumal die eine in Diktaturgeschichte oder die Geschichte einer untergegangenen Diktatur, die ja auch jeder anders erlebt hat. Also wenn ich in der Funktionärsfamilie aufgewachsen wäre, dann ist das was anderes, als wenn mein Vater in der Opposition ist und ich darunter zu leiden habe. Und so kann man verschiedene Gedächtnistypen ausmachen im Osten. Der Potsdamer Zeithistoriker Sapro hat mal so drei Gedächtnistypen genannt. Er nennt das eine Fortschrittsgedächtnis. Man könnte auch sagen, das sind jetzt die alten Kommunisten, die das alles ganz toll fanden und sagen, die DDR, das war der fortschrittlichste Staat sozial und politisch, den es jemals gegeben hat. Bei allen Fehlern. Dann nennt er das Diktaturgedächtnis. Das ist auch das, was heute eigentlich mehrheitlich in der Schule gelehrt wird. Man nimmt die DDR nur noch wahr als Diktatur. Also alles, und das lässt sich ja auch gut beweisen, es gab die Staatssicherheit, es gab keine Freiheiten, es gab keine Wahlfreiheit, keine Informationsfreiheit. Und das ist das wesentlich strukturelle Merkmal der DDR. Und es gibt ein Gedächtnis, und ich glaube, das betrifft dann die meisten, er nennt das Arrangementgedächtnis. Das ist sowohl als auch. Ja, die DDR war eine Diktatur und sie hat mich behindert in meinem Vorankommen. Ich konnte dies nicht, ich konnte jenes nicht. Aber ich habe versucht, mich zu arrangieren und im Rahmen des mir Möglichen ein sinnvolles und erfülltes Leben zu führen. Und das ist sozusagen, wenn man jetzt nur auf den Osten blickt, schon im Osten selbst, es gibt ja nicht die Ossis, sondern wir haben eben diese Gedächtnistypen in unterschiedlicher Form, die eben sich miteinander streiten. Was ist jetzt aber eigentlich die richtige DDR, über die wir da reden könnten? Meine Antwort wäre, die gibt es nicht. So wie es das Mittelalter nicht gibt und die Antike nicht gibt, es gibt ein Fortschreiten der Wissenschaft, auch innerhalb der Geschichtswissenschaft selbst einen ständigen Diskurs darüber, was wir hier eigentlich machen und wie valide unsere Aussagen sind. Es gibt die Extremposition, die würden sagen, Vergangenheit ist Vergangenheit. Da gibt es nichts zu rekonstruieren. Oder ich kann nicht wirklich Aussagen treffen. Ich kann es ja nicht mal beweisen. Ich kann natürlich aber trotzdem Aussagen über die Vergangenheit treffen. Aber die sind wiederum auch abhängig von meiner Perspektive. Als Antikommunist würde ich eine Geschichte der DDR anders erzählen als als kritischer Sozialist. Wir haben aber dasselbe Quellenmaterial, aber wir kommen zu unterschiedlichen Schlüssen in der Bewertung. Und insofern ist die Vorstellung, man könne endgültige Aussagen über die Vergangenheit treffen, die für alle Zeiten gelten, nicht möglich. Also man kann sicherlich das eine oder andere Faktum, dann und dann war was und dann und dann war dies und das und jenes. Aber wie wir das bewerten, wie wir es sehen, wie wir es gewichten, ob es überhaupt noch wichtig für uns ist, da zeigt sich Geschichte eben etwas, was mehr über die Gegenwart aussagt, in der sie geschrieben wird, als über die Vergangenheit selbst.
----
00:38:51 BENEDIKT EINERT
Aber was man vielleicht ergänzen kann, obwohl du es gesagt hast, ist, dass das nicht heißen soll. Ich glaube, gerade in der Lehrerausbildung ist das dann ganz wichtig. Das heißt nicht Beliebigkeit. Also nur wenn wir ständig von Perspektiven sprechen. Also selbstverständlich gibt es dann Perspektiven auf Geschichte, aber es gibt dann natürlich einen harten Faktor. Das ist die Quelle. Und die hat ein Vetorecht. Und was in Quellen nicht überliefert ist, von dem wissen wir nicht, ob es stattgefunden hat oder nicht. Und die Quelle hat am Ende das letzte Wort. Und alle unsere Perspektiven - das ist im Prinzip das, was der Geschichtsunterricht dann irgendwann leisten soll - alle Perspektiven, die wir einnehmen oder die Menschen einnehmen, müssen stehen auf dem Quellenfundament. Und sonst ist es natürlich, also es gibt Fakten, es ist glaube ich gerade in diesen Zeiten wichtig, das nochmal einordnen zu sagen. Selbstverständlich ist die Geschichte oder die Geschichtswissenschaft, weil du das so fragtest, das ist subjektiv am Ende, wer da schreibt und wer erzählt. Aber es ist nicht so, dass es nicht Überprüfbarkeit gäbe.
----
00:39:58 MICHAEL PLOENUS
Subjektiv ist zum Beispiel das Interesse, das der Historiker oder die Historiker an einem Gegenstand hat. Nirgendwo steht geschrieben, beschäftige dich damit. Das ist sozusagen biografisch, wo auch immer es herkommt, motiviert. Und das ist, glaube ich, so eine Grunderkenntnis. Das unterscheidet vielleicht auch den Geschichtsunterricht vom Geschichtsstudium, dass man erstmal lernt, nichts ist sicher. Wir stehen hier auf ganz unsicherem Boden. Aber, gut, dass du es nochmal ergänzt hast. Das heißt nicht, dass wir uns nicht an sowas wie Objektivität zu orientieren hätten. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit einem Gericht, wo wir aber möglichst alle Figuren in einer Person sind. Wir sind der Ankläger, der Staatsanwalt, wir sind aber auch der Verteidiger und am Ende hoffentlich der weise Richter, wenn es um Entscheidungen geht. Und das ist, glaube ich, das Erste, was die Studis lernen. Diese Objektivität gibt es nicht. Dann verfallen sie oft ins andere Extrem und sagen, es ist alles subjektiv. Aber das ist eben auch nicht. Es ist eben nicht beliebig, sondern wie du schon sagtest, die Quelle hat das letzte Wort oder die Quellen haben das letzte Wort und daran muss es sich beweisen. Also beweisen ist jetzt das falsche Wort. Es muss sich messen lassen, ob ich da richtig gewichte oder eben nicht. Aber um die Perspektivität in der Geschichtswissenschaft kommen wir halt nicht drumherum. Also schon vor 100 Jahren, behaupte ich mal, haben die Leute schon dieselben Quellen fürs Mittelalter gehabt wie wir heute. Es kommt immer mal was dazu. Aber dennoch ändert sich halt immer wieder der Diskurs und man findet einen neuen Aspekt und man diskutiert etwas Neues. Da ist auch die Geschichtswissenschaft abhängig von Moden. Stichwort Frauengeschichte, Feminismus. Das war in den 60er Jahren in der Bundesrepublik in der Geschichtswissenschaft kein Thema. Da braucht es erst einen gesellschaftlichen Wandel, der dann auch irgendwann in der Geschichtswissenschaft ankommt. und zu neuen Fragen führt und damit auch zu neuen Forschungsfeldern.
----
00:41:53 DOMINIK BARTELS
Wir sind ja 35 Jahre vergangen seit der Wiedervereinigung und es ist ja im historischen Kontext immer so, dass man zunächst erstmal eine gewisse Zeit braucht, um so eine Zäsur, die ja da stattgefunden hat, einfach auch wissenschaftlich einzuordnen. Quellen müssen gesichtet werden, Zeitzeugen werden angehört, sicherlich verschiedene Ereignisse, die da waren, müssen erstmal wieder richtig eingeordnet werden und so weiter. Mich würde mal interessieren, weil ich ja damals, so in den Anfang der 90er Jahre noch Abitur gemacht habe, da war die deutsche Teilung, Wiedervereinigung und so weiter, also dieser Aspekt der deutschen Geschichte gar kein Thema. Deswegen würde mich jetzt persönlich mal interessieren, vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer, wie sieht das dann im Moment aus bei der Lehrerausbildung oder Lehrerinnenausbildung für den Geschichtsunterricht? Nimmt denn dieses Thema deutsche Teilung eigentlich überhaupt Raum ein? Oder ist man da noch weit entfernt von, dass man sagen kann, so ja, das kommt irgendwo. im schulischen Kontext vor. Ich weiß natürlich von anderen Gesprächspartnern auch, dass da Exkursionen stattfinden, dass sie mit ihrer Schulklasse eben auch mal da irgendwo hinfahren, sich das angucken und so weiter. Aber ist es denn wirklich so im Schulalltag ein Thema?
----
00:43:00 MICHAEL PLOENUS
Also es ist nicht unbedingt auch im Studium ein Thema. Also wir arbeiten ja nicht ein Curriculum in dem Sinne ab, dass es da jetzt also 50 Themen gibt und vom ersten bis zum letzten Semester durchläuft man das, sondern man wird ja eher vertraut gemacht, mit historischem Denken, wie funktioniert das und wie gehe ich methodisch an bestimmte Dinge ran. Und es ist immer abhängig von der Universität und dem jeweiligen Professor oder dem jeweiligen Lehrstuhl, den jeweiligen Mitarbeitern, wo da die Interessen liegen. Und ich würde mal behaupten, je tiefer sie in den Westen fahren, desto weniger, das ist auch, glaube ich, empirisch belegt, desto weniger DDR -Geschichte findet an Universitäten statt. Also wenn der Prof nicht gerade irgendwie eine Neigung hat oder eine biografische Verortung in dieser Richtung, wird er diese Themen nicht unbedingt behandeln. Es zwingt ihn auch niemand. Und in der Schule ist es so, wenn man dahin kommt, das war ja früher auch so, wo hört man auf, wie weit kommt man in der Geschichte? Das fängt man ja immer noch in der Antike an und geht durch. Und das Thema deutsche Teilung und deutsche Vereinigung ist meines Erachtens schon im Lehrplan drin und wird auch gelehrt. Die Frage ist, wie viel bleibt davon hängen? Und bei unseren Studis, für die ich ja jetzt nur sprechen kann, oft nicht viel. Also ich mache am Anfang solcher DDR-Seminare immer mal nur nach Walter Ulbricht oder der Spreewaldgurke und was halt so an Wissenspartikeln da ist. Und naja, es erschöpft sich halt meistens in der Banane, im Trabi, in Erich Honecker, Stasi, Grenze, Kommunismus. Im Wesentlichen war es das. Und wenn man jetzt noch familiär was hat, dann kommt noch das ein oder andere mehr. Aber da fangen wir dann auch bei denjenigen, die es also hoffentlich intrinsisch motiviert studieren, fangen wir wieder an. Und was ich allerdings sagen kann, die Neugier ist nach wie vor recht groß und das Interesse an den Themen ist recht groß. Ich habe tatsächlich auch gerade ein DDR -Seminar gemacht und wir fahren auch auf Exkursionen, ich weiß gar nicht, ob ich das sage, wir fahren nach Thale, in dieses DDR -Museum. Also, naja, oder sagen wir mal, in diese Sammlung aus Ampelmännchen, Spreewald-Gurken, Bläser und Fakten. Und sind aber sehr gespannt und wir sind jetzt auch schon entsprechend kritisch präpariert. Und ich bin sehr gespannt, was bei dieser Extrusion rauskommt und wie das empfunden wird und vor allem hinterher diskutiert wird.
----
00:45:21 DOMINIK BARTELS
Hast du gar nichts hinzuzufügen. Ich habe nämlich oft das Gefühl, das war Hintergrund der Frage im Grunde genommen, dass ich oft das Gefühl habe, ja, weil du das auch gut beschrieben hast, also umso weiter oder so tiefer man in den Westen geht, sagen wir mal einfach mal so im Ruhrgebiet oder Rheinland-Pfalz. als Beispiele nur, dass dort nicht angekommen ist, was für eine gewaltige Zäsur in der deutschen Geschichte diese Wiedervereinigung eigentlich wirklich gewesen ist. Und ob das vielleicht, deswegen auch die Frage jetzt an euch.